Schuldenbremse, Sparmythen und fehlende Gerechtigkeit: Der deutsche Wirtschafts-Diskurs in der Sackgasse
Es ist ein immergleiches Spiel: Statt über die Verteilungswirkung politischer Entscheidungen zu streiten, oder Alternativen zu neoliberaler Sparpolitik nachzudenken, wird die Debatte stets auf technokratische Formeln, Haushaltsdisziplin und scheinbar alternativlose Sachzwänge reduziert. So wird Politik zu einem reinen Verwaltungsakt und Demokratie zur Kulisse.
Das betrifft aber längst nicht nur Regierung oder Opposition, sondern auch die mediale Vermittlung: zu oft werden Erzählungen der Regierenden oder der finanzpolitischen „Vernunft“ reproduziert. Diese Diskursverengung ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erzählungen über „gute Haushaltsführung“, über den Staat als disziplinierter Sparer – nicht als aktiver Gestalter. Und sie wird heute fortgeschrieben, trotz multipler Krisen und wachsender Ungleichheit. Das macht sie so gefährlich: Denn wer nicht über Alternativen spricht, macht sie unsichtbar – und hält den Status quo für naturgegeben.
Ein aktueller Tagesschau-Artikel zum Bundeshaushalt 2025/26 zeigt stellvertretend, wie diese Einseitigkeit aussieht: Technokratische Verklauselungen, Fixierung auf Sparzwang, und die unkritische Übernahme von populistischen Mythen.
Neuverschuldung ja – aber unzureichend und sozial ungerecht
Der erwähnte Tagesschau-Artikel erkennt immerhin an, dass in der aktuellen Lage eine höhere Neuverschuldung notwendig ist – das ist ein kleiner Fortschritt. Aber genau hier endet alles scheinbar Progressive auch schon. Denn was untergeht: Die bislang diskutierte und beschlossene Neuverschuldung reicht bei Weitem nicht aus, um die strukturellen Herausforderungen zu bewältigen. Im Gegenteil – selbst mit den zusätzlichen Schulden bleiben massive Finanzierungslücken im Haushalt. Und wie sollen die gestopft werden? Nicht durch gerechte Steuerpolitik oder mutige Investitionen, sondern auf dem Rücken derjenigen, die ohnehin schon wenig haben.
Das Bürgergeld soll weiter gekürzt werden. Leistungen für internationale Solidarität und soziale Infrastruktur stehen zur Disposition. Gleichzeitig gibt es kein einziges Wort in dem Artikel, dass gerechte Steuern auf Vermögen oder Kapital die benötigten Einnahmen schaffen könnten und zugleich die dringend nötige Verteilungsgerechtigkeit herstellen würden. Ein zentrales Thema, das einfach ausgeklammert wird. Keine Rede von Vermögensabgaben, keinerlei Erwähnung der absurden Steuerprivilegien für Kapitaleinkünfte.
Grundsätzliche Kritik an der Schuldenbremse fehlt komplett
Ebenso fehlt eine grundsätzliche, notwendige kritische Auseinandersetzung mit der Schuldenbremse. Dieses rigide Instrument blockiert jede zukunftsorientierte Politik. Stattdessen wird der Status quo unhinterfragt akzeptiert, als gäbe es keine Alternativen.
Besonders ärgerlich ist die unkritische Wiedergabe von AfD-Positionen. Die Äußerungen werden ungefiltert übernommen, ohne sie zu hinterfragen oder einzuordnen. Dabei verbreitet die AfD nichts anderes als alte neoliberale Sparmythen, gepaart mit populistischer Panikmache gegen Klimafinanzierung und soziale Leistungen. Die Regierung „spart nicht“? Leben „auf Pump“? Das sind irreführende Narrative, die soziale Sicherheit zum Feindbild machen und Kürzungen als alternativlos darstellen. Die tatsächliche Funktionsweise unseres finanzpolitischen Systems wird durch diese Narrative ad absurdum geführt.
Technokratische Berichterstattung – gesellschaftliche Perspektiven fehlen
Der Artikel setzt fast ausschließlich auf Zahlen, haushaltspolitische Details und technische Erklärungen. Gesellschaftliche Stimmen und progressive Perspektiven fehlen. Dadurch wird die Haushaltsdebatte zur Zahlenspielerei degradiert, die politische Werte und soziale Konflikte ausblendet. Diese Engführung macht es schwer, die vielschichtigen Herausforderungen unserer Zeit überhaupt zu erfassen.
Was dabei untergeht: Hinter jeder Budgetentscheidung stehen Prioritäten. Jeder eingesparte Euro bedeutet, dass irgendwo nicht investiert wird – in Schulen, in Pflege, in Klimaschutz oder in sozialen Ausgleich. Doch anstatt diese Fragen offen zu verhandeln, vermittelt die Berichterstattung das Bild, Haushaltsdebatten seien ein technisches Managementproblem, das vor allem von „Haushaltsexperten“ unter sich gelöst werden müsse. Das entpolitisiert nicht nur zentrale Zukunftsfragen, sondern entzieht sie auch der demokratischen Auseinandersetzung.
Besonders in Zeiten multipler Krisen – von der Klimakatastrophe über soziale Ungleichheit bis hin zur globalen Instabilität – braucht es aber genau das Gegenteil: mehr Öffentlichkeit, mehr Perspektiven, mehr Streit über Alternativen. Denn gute Haushaltspolitik ist keine Frage bloßer Rechenkunst, sondern Ausdruck dessen, wie wir als Gesellschaft leben wollen.
Fazit: Ein Beispiel für ein größeres Problem
Der Tagesschau-Artikel mag auf den ersten Blick sachlich und informativ wirken, doch er steht sinnbildlich für die tiefgreifende Diskursverengung, die die wirtschafts- und finanzpolitische Debatte in Deutschland seit Jahren prägt. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Vermögens- oder Kapitalertragssteuern werden ausgeklammert, die Schuldenbremse erfährt keine kritische Hinterfragung, und zentrale soziale sowie globale Herausforderungen werden zu Nebensätzen degradiert.
Es dominieren technokratische Sprache, Sparlogik und das bloße Wiedergeben altbekannter Narrative, selbst wenn sie aus dem rechtspopulistischen Lager kommen. Der politische Gehalt von Haushaltsentscheidungen wird so entpolitisiert, die demokratische Auseinandersetzung auf Zahlenreihen und vermeintliche Sachzwänge reduziert.
Wer aber eine gerechte, zukunftsfähige Gesellschaft gestalten will, muss genau hier ansetzen: bei der Frage, wofür sind Ressourcen da – und für wen? Dafür braucht es eine pluralistische, streitbare Debatte, die alte Dogmen hinterfragt, neue Ideen zulässt und die gesellschaftlichen Folgen finanzpolitischer Entscheidungen endlich wieder in den Mittelpunkt rückt.
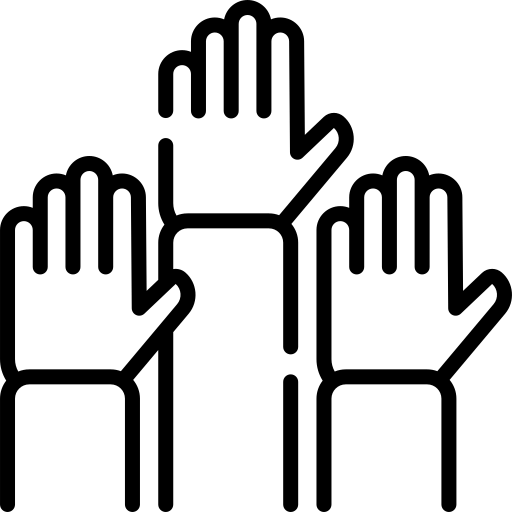

Schreibe einen Kommentar