Die heutige Kriegsnormalisierung
Bei einem Vergleich des gesellschaftlichen und medialen Diskurses vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heute ist nicht zu leugnen, in welchem Ausmaß das Produzieren, Liefern und Benutzen von Waffen innerhalb weniger Jahre normalisiert wurde – sogar als alternativlos hingestellt wird. Gerade diese Entwicklung sollte Anlass sein, innezuhalten und die aktuelle Lage kritisch zu hinterfragen. Die möglichen Zukunftsszenarien sind zu gravierend, um dem gesellschaftlichen Konsens unreflektiert zu folgen. Gleichzeitig ist das Thema zu komplex, um sich pauschal dagegen zu positionieren.

Aktuelle Ereignisse lassen besonders aufhorchen. Der Chef der vermeidlich pazifistischen Grünen Jugend, Jakob Blasel, stellt fest, dass das Verweigern von Waffengewalt zu verurteilen ist:
Wer in dieser Weltlage noch immer zögert, Europas Freiheit auch mit Waffen zu verteidigen, ist nicht links – sondern naiv und unsolidarisch.
Jakob Blasel – Vorsitzender der Grünen Jugend
Gleichzeitig stimmt die Linke in zwei Bundesländern für das Aufrüstungspaket von CDU & SPD und die EU-Kommission legt mit dem ReArm Europe Plan/Readiness 2030 einen milliardenschweren Plan zur Stärkung der gesamteuropäischen Verteidigungsfähigkeiten vor, welcher unter Anderem private Ersparnisse für Rüstungsinvestitionen mobilisieren soll.
Bemerkenswert ist die Selbstverständlichkeit, die von Links über die Mitte bis Rechts gegenüber Aufrüstung an den Tag gelegt wird. Sie wird von der Bevölkerung vor Allem unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs und der Abkehr der USA von jedweder strategischer Partnerschaft akzeptiert oder befürwortet. Ebenso stützen wirtschaftliche Interessen den Aufrüstungskurs, der Aktienkurs von Rheinmetall erreicht regelmäßig neue Höchststände.
So scheint der Kurs klar und die Akzeptanz gesichert. Doch welche Prinzipien liegen der aktuellen Stimmungsmache zugrunde. Was bedeutet es für die breite Bevölkerung, wenn ein Krieg ausbricht? Und wofür kämpfen wir am Ende überhaupt?
Die Prinzipien der Kriegspropaganda – früher sowie heute
Um nachvollziehen zu können, welcher Prinzipien sich beim Rechtfertigen von Kriegen bedient wird, lohnt sich ein Blick in zeitgenössische Literatur. Die Historikerin Anne Morelli formulierte 2001 in ihrem Buch „Die Prinzipien der Kriegspropaganda“ zehn Punkte, welche sich in den Kriegen der Moderne wiederfinden. In einer Rezension stellte der Historiker Christian Hardinghaus dabei fest, dass vor Allem Prinzipien 1 bis 4 sowie 9 in allen Kriegen der Zeitgeschichte von 1914 bis heute erkennbar seien. Im Folgenden soll sich auf diese konzentriert werden.
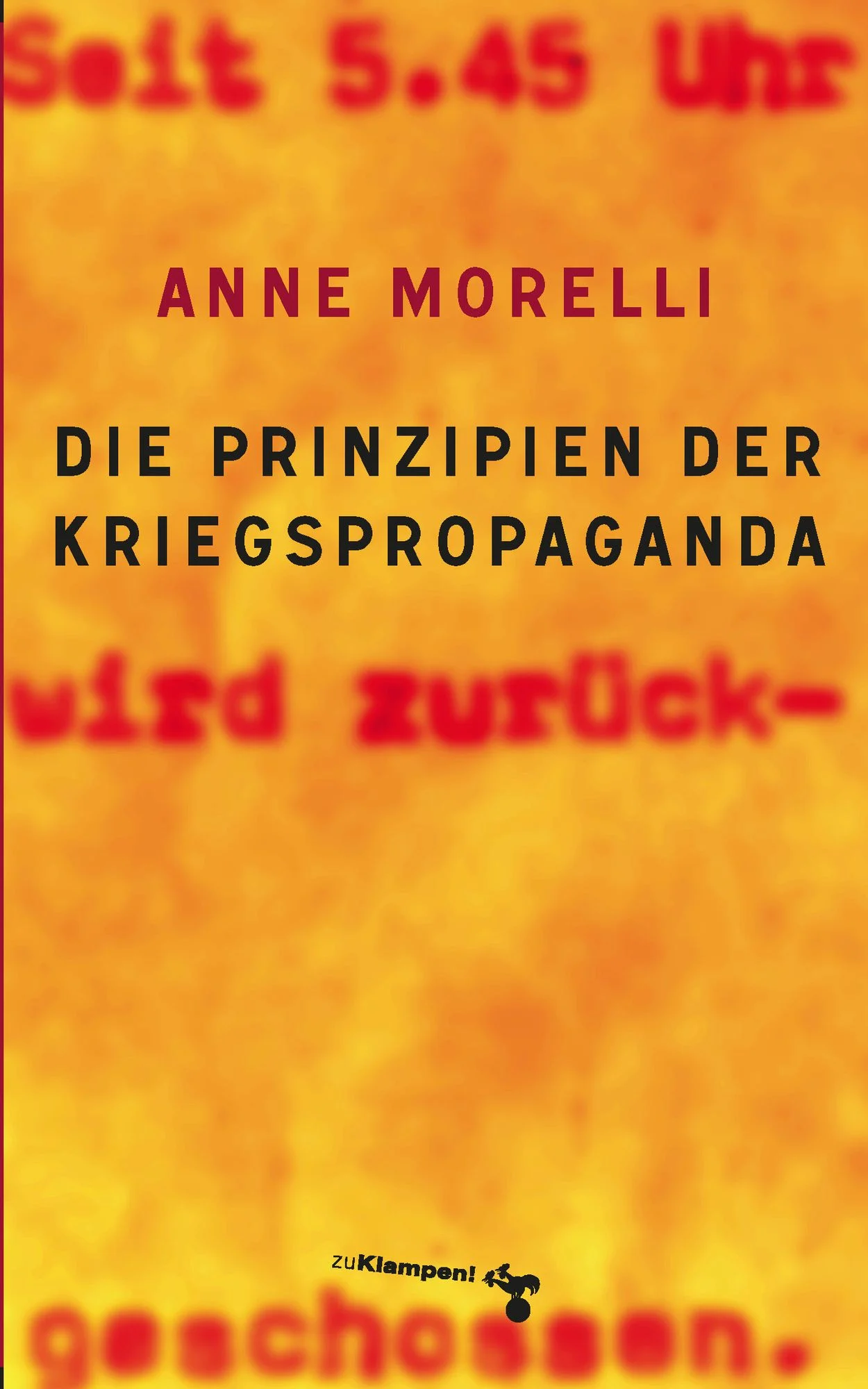
1. Wir wollen Keinen Krieg!
Staatsmänner aller Länder versichern selbst immer feierlich, dass sie den Krieg nicht wollen. Mobilisieren und gleichzeitig verkünden, dass die Mobilisierung kein Krieg sei, sondern im Gegenteil das beste Mittel, den Frieden zu sichern.
Dieses Prinzip ist bereits fest etabliert und wird mit jedem Jahr weiter gefestigt. Stellvertretend steht dafür das Zitat von Verteidigungsminister Boris Pistorius aus dem Jahr 2024:
„Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein. Wir müssen Abschreckung leisten, um zu verhindern, dass es zum Äußersten kommt.“
Boris Pistorius im Deutscher Bundestag
Dazu passen auch die ersten Maßnahmen der CDU & SPD nach den Bundestagswahlen 2025. Einerseits wurden Verteidigungsausgaben aus der Schuldenbremse herausgenommen. Andererseits findet sich im Koalitionsvertrag ein „neuer attraktiver Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert“ wieder. Das Wort „zunächst“ sollte dabei aufhorchen lassen.
2. Der Gegner ist allein für den Krieg verantwortlich!
Es wird ausschließlich reagiert. Verteidigung erfolgt gegen Provokationen des Feindes, der für den Ausbruch des Krieges uneingeschränkt verantwortlich ist.
Dieses Prinzip galt sowohl im 2. Weltkrieg, als auch für die Überfälle der USA auf Afghanistan und den Irak, dem Überfall für Russland auf die Ukraine und selbstverständlich für alle überfallenen Länder. Auch die Aufrüstung in Deutschland wird mit diesem Prinzip weiter untermauert.
Hier bleibt festzuhalten: In jedem Krieg gibt es angreifende und angegriffene Länder. Diese Positionen sollten nicht gleichgesetzt werden. Der zentrale Punkt ist, dass jedes Land, unabhängig davon, ob es angreift oder angegriffen wird, sich auf dieses Prinzip zur Mobilmachung beruft. Auch in Deutschland, in der die Gefahr eines bevorstehenden Krieges tagtäglich ausdiskutiert wird, ist es nicht anders.
Inwiefern diese Behauptung in der jeweiligen spezifischen Situation zutrifft, unterliegt dem Urteilsvermögen eines jeden selbst. Dieses Urteil sollte in jedem Fall mit äußerster Vorsicht getroffen werden.
3. Der Führer des feindlichen Lagers wird dämonisiert
Der gegnerische Anführer ist nicht nur der Gegner, sondern moralisch verwerflich, grausam und unmenschlich.
Mit diesem Prinzip wird eine moralische Rechtfertigung für eine Invasion oder Mobilmachung geschaffen, laut derer die Welt vor einem gefährlichen Tyrannen geschützt werden muss. Sowohl die Invasion des Iraks (Saddam Hussein), als auch das militärische Eingreifen in Osteuropa (Slobodan Milošević) wurden damit legitimiert, obwohl es gegen die internationale Regelungen verstieß.
Auch Wladimir Putin, ohne Frage ein Imperialist und Kriegsverbrecher, ist Gegenstand dieses Mittels, wenn er mit Adolf Hitler („Putler“) gleichgesetzt wird. Das gleichzeitige Appellieren an die westliche Einheit und das Mobilisieren der öffentlichen Meinung begünstigt die weitgehende Akzeptanz für den aktuellen Aufrüstungskurs und Diskussionen über die Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Um die eigentliche Moral geht es dabei nicht. Sie wird benutzt, um entsprechende Ziele und Vorhaben zu legitimieren. Dementsprechend ist Vorsicht geboten, wenn Argumentationen vorwiegend auf moralisch-emotionalen Appellen basieren.
4. Wir verteidigen ein edles Ziel und keine besonderen Interessen!
Wir kämpfen nicht aus Eigennutz, sondern für höhere Werte wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte oder Frieden.
Dieses Prinzip dient sowohl der Akzeptanzsteigerung als auch der Verschleierung von wahren Interessen wie geopolitische Macht oder Ressourcen. Sowohl beim Überfall auf den Irak als auch auf Afghanistan ging es um Einfluss und Ressourcen.
Wenn heute von der Verteidigung der Demokratie vor dem imperialen Russland geredet wird, dann mag das tatsächlich ein Grund sein, der in der öffentliche Debatte nicht unterschlagen werden sollte. Doch ehrlicherweise müssten knallharte strategische Interessen wie die Eindämmung russischen Einflusses und die Stärkung der NATO ebenfalls offen auf den Tisch gelegt werden.
9. Unser Anliegen hat etwas Heiliges
Wir führen einen heiligen Kampf für das Gute, Gerechte und Menschliche.
Dieses Prinzip hängt eng mit dem vierten Prinzip zusammen und dient insbesondere der moralischen Entwertung von Kritik.
Am bekanntesten sind wohl die Aussagen von George W. Bush im Zusammenhang mit dem „Krieg gegen den Terror“ über den „Kreuzzug“ und dem göttlichen Auftrag zur Verteidigung der Freiheit. Ähnlich argumentiert heutzutage auch die russische Führung, wenn sie vom „Schutz der russischen Welt“ und einem religiösen Auftrag, russische Kultur und Werte gegen den „verfallenen Westen“ zu verteidigen. Doch auch die Akzeptanz für Waffenlieferungen an die Ukraine wurde oft als moralische Pflicht dargestellt, womit Kritik von vornerein entwertet wurde.
Es gilt erneut, sich davor zu hüten, sich auf eine rein moralische Ebene und Argumentationen geleitet von Emotionen einzulassen.
Die Parallelen zwischen der heutigen öffentlichen Berichterstattung und den Prinzipien der Kriegspropaganda lassen sich nicht leugnen. Gleichzeitig gibt es noch keinen Grund für Fatalismus. Die weltweiten kriegerischen Auseinandersetzungen nehmen zu und tangieren zunehmenden den globalen Westen. Das heißt jedoch nicht, dass zwangsweise ein Weltkrieg daraus folgen muss. Der erste Schritt ist, den öffentlichen Diskurs kritisch zu reflektieren und sich nicht einer eskalierenden gesellschaftlichen Dynamik hinzugeben. Gleichzeitig sollte es nicht gescheut werden, sich mit dem Worst-Case-Szenario eines Krieges auseinanderzusetzen. Dabei ist die zentrale Frage: Wofür kämpfe ich eigentlich?
Warum und wofür soll ich eigentlich kämpfen?
Für die meisten Menschen ist es erst dann eine Option, selbst zu kämpfen, wenn alle anderen Lösungswege ausgeschöpft sind und ihr eigenes Wohl oder das nahestehender Personen unmittelbar bedroht ist. In einem direkten Konflikt sind die Interessen der beteiligten Parteien meist deutlich erkennbar. Ein Krieg hingegen – insbesondere zwischen Nationen – stellt eine weitaus komplexere Realität dar. Machtstrukturen, Interessen, Hierarchien und dynamische Entwicklungen überlagern sich und machen das Geschehen schwer durchschaubar. Menschen, die eigentlich ein friedliches Leben führen wollen, finden sich plötzlich an der Front wieder und schießen auf Fremde – Menschen, die ihnen nie etwas angetan haben. Und über all dem steht die Frage: Warum? Es gibt viele Gründe, warum Kriege geführt werden – und ebenso viele Ziele, die Machthaber mit ihnen verfolgen. Doch was bewegt einen Zivilisten dazu, im Falle eines Angriffs zur Waffe zu greifen und auf fremde Menschen zu schießen?
Krieg und verschiedene Motivationen
Die erste, offensichtlichste „Motivation“ ist keine Motivation, sondern Zwang. Wenn ein Land in den Kriegszustand übergeht, geraten Demokratie und Freiheit in den Hintergrund. Wer sich verweigert, an die Front zu folgen, riskiert Gefängnis – oder im schlimmsten Fall die Exekution. Die einzige Alternative bleibt die frühzeitige Flucht, andernfalls wird man in einen Strudel gezogen, aus dem es kein Entkommen gibt.

Doch längst nicht alle Menschen verweigern den Kriegsdienst. Viele melden sich freiwillig und ziehen bereitwillig für ihr Land in den Krieg. Was treibt sie dazu, ihr Leben zu riskieren – und im Extremfall andere Menschen zu töten? Eine zentrale Unterscheidung ist dabei entscheidend: Das persönliche private Wohlbefinden ist nicht zwangsläufig an das Wohlbefinden des eigenen Staates gebunden – es kann aber. Wann sich im Kriegsfall die eigenen Interessen mit den Interessen des eigenen Staates überschneiden – das ist die Frage, dich sich ein jeder stellen sollte.
Der Staat ist ein ambivalentes Gebilde. Einerseits bildet er den zentralen Rahmen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Viele zivilisatorische Errungenschaften – von der liberalen Demokratie über die Garantie von Menschenrechten bis hin zum Sozialstaat – sind untrennbar mit ihm verbunden. Ein großer Teil der Bevölkerung identifiziert sich mit dem Staat und häufig auch mit der eigenen Nationalität. Diese Identifikation kann so stark und irrational ausgeprägt sein, dass sie für manche allein Grund genug ist, zur Waffe zu greifen.
Doch das Bild eines Staates „von den Bürgern für die Bürger“ ist eine idealisierte Vorstellung. Selbst in westlichen Demokratien sind politische Entscheidungsträger oft weit entfernt von der Lebensrealität großer Teile der Bevölkerung. Die wirtschaftlichen Interessen der herrschenden Klasse unterscheiden sich grundlegend von denen der lohnabhängigen Mehrheit. Lobbyismus beeinflusst politische Prozesse im Hintergrund, und viele Entscheidungen fallen spürbar zugunsten der wirtschaftlich Privilegierten. Während von oben Solidarität beschworen wird, erleben wir gleichzeitig die bewusste Spaltung der Gesellschaft – etwa durch Stimmungsmache gegen armutsbetroffene Menschen, Migrant*innen und andere marginalisierte Gruppen.
In Anbetracht dieser Widersprüche lässt sich nicht einfach beantworten, wann und ob sich die eigenen Interessen tatsächlich mit denen des Staates decken – geschweige denn, ob es im eigenen Interesse liegt, für ihn zur Waffe zu greifen. Eine entscheidende Unterscheidung muss in Bezug auf die Art des Krieges getroffen werden: Sieht man sich mit einem Eroberungskrieg oder einem Vernichtungskrieg konfrontiert?
Ein erfolgreicher Eroberungskrieg führt aus Sicht der Bevölkerung des angegriffenen Landes meist zu einer Verschlechterung der Lebensverhältnisse. Doch zunächst bedeutet er vor allem eines: ein Wechsel der politischen Führung. Die westliche liberale Demokratie wird oft als Idealbild gefeiert. In der Realität jedoch dominieren zunehmend Kapitalinteressen den politischen Prozess, während der demokratische Wille der Bevölkerung in den Hintergrund rückt. Für viele sind die Lebensbedingungen bereits heute angespannt oder gar prekär. Öffentliche Infrastruktur verfällt, soziale Ungleichheit wächst, und die Klimakatastrophe wird weiter befeuert. Vor diesem Hintergrund lässt sich zumindest darüber diskutieren, ob die mögliche Verschlechterung der Lebensumstände unter einem hypothetischen autoritären Regime – etwa durch eine russische Besatzung – den höchsten persönlichen Einsatz rechtfertigt: das eigene Leben. Oder ob es nicht vielmehr im individuellen Interesse liegt, zu fliehen oder zu desertieren, statt sich für ein System zu opfern, in dem die eigenen Interessen allenfalls nachrangig priorisiert werden.

Anders sieht es bei einem Vernichtungskrieg aus, insbesondere wenn marginalisierte oder global verfolgte/unterdrückte Gruppen betroffen sind. Hier liegt eine große Überschneidung der Interessen der Bevölkerung und des angegriffenen Staates vor. Wenn das eigene Überleben und das der nahestanden Menschen vom Überleben des Staates abhängt, dann wird der Griff zur Waffe im schlimmsten Fall unumgänglich. Auch bei einer globalen Ausnahmesituation wie im 2. Weltkrieg, als die Welt kurz davor stand, von einem vernichtenden Faschismus eingenommen zu werden, scheint ein gewaltsamer Eingriff alternativlos.
Letztlich lässt sich nicht pauschal beurteilen, ob es im Kriegsfall sinnvoll ist, zur Waffe zu greifen. Die Entscheidung hängt von der konkreten Situation, den persönlichen Umständen und der Art des Konflikts ab. Ein Vernichtungskrieg erfordert andere Antworten als ein Eroberungskrieg, ebenso wie beispielsweise ein funktionierender Sozialstaat andere Bindungen schafft als ein System, das seine Bürger vernachlässigt. In einer Welt, in der politische Macht oft im Dienst wirtschaftlicher Eliten steht und Solidarität nach außen gepredigt, nach innen jedoch untergraben wird, ist jedoch höchste Wachsamkeit geboten. Wer kämpft – kämpft nicht automatisch für Freiheit, Gerechtigkeit oder das Gute. Deshalb sollte jede*r sich im Angesicht des Krieges eine grundlegende Frage stellen: Kämpfe ich wirklich für meine eigenen Interessen – oder für die Interessen anderer, die mich lediglich instrumentalisieren?
Fazit
Die zunehmende gesellschaftliche Normalisierung von Aufrüstung und Kriegsbereitschaft, die sich in Politik, Medien und Öffentlichkeit beobachten lässt, ist ein beunruhigendes Zeichen unserer Zeit. Inmitten geopolitischer Spannungen, wirtschaftlicher Interessen und medialer Erzählungen droht die individuelle Urteilsfähigkeit zu verblassen. Doch gerade jetzt ist kritisches Denken wichtiger denn je. Wer sich den öffentlichen Narrativen leichtfertig hingibt, oder irrationalen Vorstellungen über Nationalität und Ehre folgt, erlebt möglicherweise unerwünschte Konsequenzen. Es gilt, sich ehrlich zu fragen, ob man wirklich für die eigenen Interessen kämpft und wie stark sich die eigenen Interessen tatsächlich mit den Interessen des Staates überschneiden.
In einer Zeit, in der der Krieg als alternativlos dargestellt wird, ist die radikalste Tat womöglich nicht der Griff zur Waffe – sondern der Wille, sich nicht vereinnahmen zu lassen.
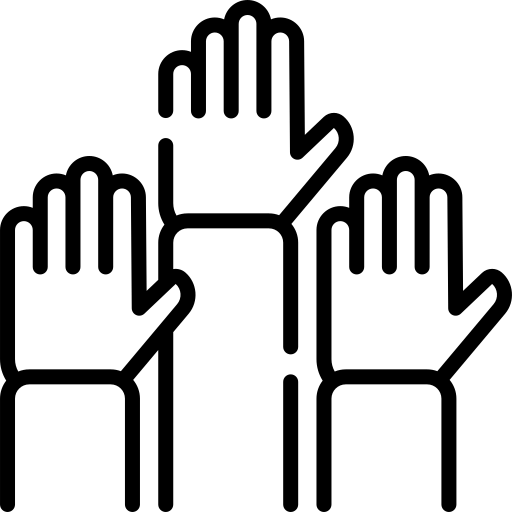

Schreibe einen Kommentar